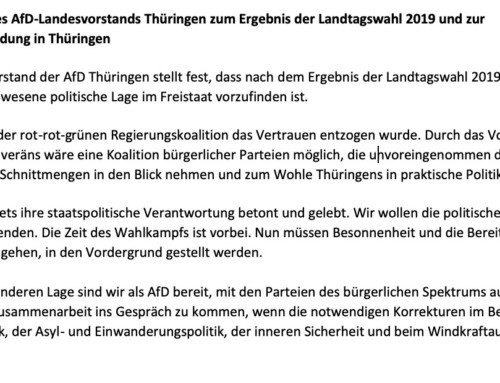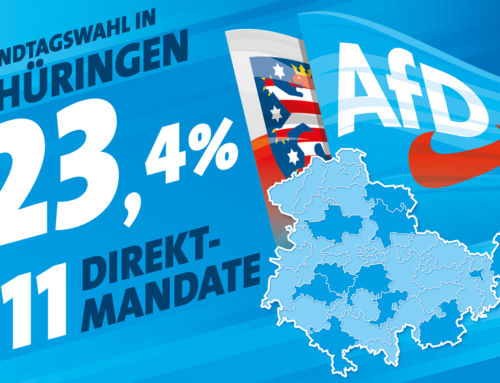Das Unabhängigkeitsreferendum am 18. September ist eine Weichenstellung für das neue „Europa der Vielfalt“
Die Alternative für Deutschland hat sich das Eintreten für direktdemokratische Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger, für die Stärkung überschaubarer politischer und wirtschaftlicher Räume in der Europäischen Union und für Souveränitätsrechte von Völkern auf ihre Fahnen geschrieben. Ja, die Forderung nach mehr freier Selbstbestimmung und Dezentralisierung auf allen Ebenen kann mit Fug und Recht als eines der wichtigsten Grundprinzipien der Partei gelten. Erst kürzlich hat Bernd Lucke in seiner Stellungnahme zum EU-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine erneut das Selbstbestimmungsrecht der Völker betont, das auch für mehrheitlich sezessionistisch gesinnte Volksgruppen und Landesteile gelten müsse, sofern deren Abtrennung in geordneten Bahnen verlaufe.
Der 18. September 2014 ist vor diesem Hintergrund ein Schlüsseldatum Das Referendum im Norden der britischen Insel hat eine weitreichende Signalwirkung nicht nur für die Schotten, die an diesem Tag über eine einfach klingende, aber folgenschwere Frage zu entscheiden haben: „Soll Schottland ein unabhängiges Land werden?
Die schottische Nationalbewegung kann auf eine erstaunliche Erfolgsgeschichte in den letzten anderthalb Jahrzehnten verweisen: Durchsetzung eines eigenen Parlaments 1999, erster Wahlsieg der Scottish National Party (SNP) 2007, Gewinn der absoluten Mehrheit der Mandate 2011 und Durchsetzung einer vertraglichen Regelung zwischen der Zentralgewalt in London und der Regionalregierung in Edinburgh über das jetzige Referendum im vergangenen Herbst.
Allen Umfragen der letzten Woche zufolge gibt es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der für einen Verbleib bei Großbritannien eintretenden „No“-Kampagne und der vom schottischen First Minister Alex Salmond geführten „Yes“-Bewegung. Noch Anfang August lagen die Umfragewerte für das „Yes“-Lager um über zehn Prozent unter den jetzigen, und im letzten Jahr waren es nicht selten sogar über 15 Prozent weniger. Somit ist festzuhalten (gleich wie man die Aussagekraft der Studien von politisch keinesfalls immer ganz unabhängigen Meinungsforschungsinstituten im Detail beurteilen mag), dass sich die Anhänger nationalstaatlicher Souveränität, die sich der jahrhundertelangen historisch-kulturellen Eigenentwicklung Schottlands verpflichtet fühlen, stimmungsmäßig klar auf der Überholspur befinden.
Schon seit Jahren ist die SNP der mit Abstand dynamischste politische Faktor des Landes. Gesellschaftspolitisch links stehend, vereinigt die von ihr geführte, aus Dutzenden höchst unterschiedlichen Organisationen bestehende Unabhängigkeitsbewegung weite Teile der regional verankerten Wirtschaft und fast die gesamte schottischen Kulturszene. Mitglieder der Grünen und der Gewerkschaften sammeln sich ebenso hinter Salmond wie Teile der von der Labour Party zunehmend entfremdeten Arbeiterschaft; auch zahlreiche Bauern und Fischer sowie ein noch bis in die 1960er Jahre über lange Zeit hinweg die Torys bevorzugendes konservatives Bürgertum ist Teil der Unabhängigkeitsbewegung. Letzterem stellt der geschickte Politstratege Salmond entgegen früheren Programmen mittlerweile ein souveränes Schottland inklusive Queen, Pfund Sterling und Nato-Mitgliedschaft in Aussicht.
Im Referendumswahlkampf setzte die Yes-Kampagne die Akzente, etwa wenn sie den Erhalt der kostenfreien schottischen Universitäten betonte oder sich gegen die von England aus vorangetriebene Privatisierung der Krankenversorgung durch den staatlichen National Health Service aussprach. Demgegenüber agierten die Anhänger der „Better Together“-Kampagne fast ausschließlich defensiv und ohne Elan. Griffige Visionen zur Zukunft des Landes fehlten. Staat dessen wurde das laue Motto ausgegeben, der Bürger möge sich doch lieber für das ungeliebte Bekannte als für das Risiko eines Neuanfangs voller Fragezeichen entscheiden. Die entsprechenden Stichworte hießen Währungsunsicherheit, mögliche Neubeantragung der EU-Mitgliedschaft und mangelnde Seriösität der in der Tat gewagten wohlfahrtsstaatlichen Versprechungen der SNP-Regierung, die, so der Vorwurf, auf unberechenbaren und zu hoch angesetzten Einnahmen aus dem Nordseeöl beruhten.
Offene Bekenntnisse zum britischen Einheitsgedanken, den gemeinsamen geschichtlichen Erfahrungen und Prägungen vor allem des 19. und 20. Jahrhunderts gibt es so gut wie keine mehr. Union Jack-Fahnen in Schottland sind rar und das schottische Andreaskreuz auf blauem Grund allgegenwärtig. Die britische Identität ist – und das lässt sich auch in Wales und selbst in England feststellen – weitgehend erodiert.
Der Nationalbewegung in Schottland gehört die Zukunft. Sie ist modern, selbstbewußt und von ihrer Struktur und Programmatik her derart vielfältig, dass ihr die althergebrachten politischen Rechts-Links-Schemata in keiner Weise gerecht werden. Selbst wenn sich am 18. September eine knappe Mehrheit für den Status quo entscheiden sollte, würde das die weitere Dezentralisierung Großbritanniens nicht verhindern, zumal aus London zuletzt bereits eine Reihe von Versprechungen gemacht wurden, wie die Autonomierechte des Nordens beispielsweise in puncto Steuer-Souveränität weiter ausgebaut werden könnten.
Allenfalls kann mit einem „No“ der Dominoeffekt verhindert bzw. aufgeschoben werden, den ein „Yes“ zweifellos auslöst. Die internationalen Folgen eines Unabhängigkeitsvotums in Schottland wären gewaltig – etwa in Oberitalien (in der Lombardei findet am 18. September ebenfalls ein Unabhängigkeitsreferendum statt), in Belgien und im besonders fragilen spanischen Zentralstaat, wo die Katalanen eine Volksabstimmung am 9. November (!) vorbereiten und auch die in ähnlichem Maße unter der spanischen Transferunion leidenden Basken längst in den Startlöchern stehen. In die irische Frage, die Autonomiebestrebungen ungarischer Volksgruppen oder in die Südtirol-Problematik würde ebenfalls sofort jede Menge Bewegung gebracht werden.
Das schottische Referendum erscheint vor diesem Hintergrund als Menetekel. Wohin soll der Weg unseres Kontinents führen? Geht es weiter in Richtung Integration und Vereinheitlichung, also hin zu größeren, mehr oder weniger anonymen Entscheidungsräumen, sprich: immer mehr „Globalisierung“ in Politik, Kultur und Wirtschaft? Oder setzt sich ein dezentraleres, bürgernahes, demokratischeres Politikverständnis durch, das den unterschiedlichen ethno-kulturellen Prägungen Europas Rechnung trägt und Machtzentralisierungen nur dort als Fortschritt betrachtet, wo sie unumgänglich erscheinen und allgemeinem Nutzen versprechen?
Fällt der schottische Dominostein, dann wäre das nicht zuletzt als eine Mißtrauenserklärung gegen die real existierende Brüsseler EU- und Euro-Konstruktion zu verstehen und als Signal für einen selbstbewussten Neubeginn in einem Europa der Vielfalt.
Martin L. Schmidt
Regionalreferent Rheinland-Pfalz